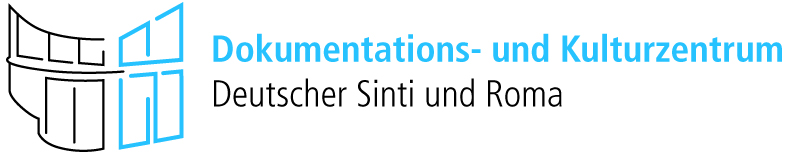Jasmin Dickerson: Ableismus
Wir sind alle ableistisch sozialisiert, das kann man aber verlernen! Finde heraus, was Barrierefreiheit und Inklusion wirklich bedeuten und wie wir sie umsetzen können. Öffne dich für neue Wege der Antidiskriminierung und arbeite gemeinsam mit mir am Thema Inklusion und Zusammenhalt.
Irene Portugal: Wie in der NS-Zeit Homosexualität als Krankheit deglariert wurde
In diesem Dreiklang wird sich unsere zeitgeschichtliche Betrachtung von Homosexualität bewegen, also in den Wellen von Stigmatisierung, exkludierender Krankheitsdefinition und den emanzipatorischen Kämpfen der Homosexuellenbewegungen.
Wir betrachten wie vom Kaiserreich bis in die Nachkriegszeit Homosexualität als Krankheit klassifiziert und kriminalisiert wurde, wie eugenische Argumente vor allem in der NS-Zeit Homosexuellenverfolgung bis in den Tod ermöglichten und wie dieses stigmatisierende Denken bis heute nachwirkt. Neben der im § 175 fixierten Kriminalisierung von Homosexualität werden wir auch aufzeigen, dass mit dem Transsexuellengesetz es ebenfalls eine Fortschreibung eugenischer Argumente gibt und mit welchen Diskursen wir darauf reagieren können.
Dr. Gisela Tascher: “Euthanasie” und Zwangssterilisation im Saarland 1935 bis 1945 und Diskussion zum Thema: Eugenik und Rassenhygiene in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus – Gesundheit und Krankheit als Vision der Volksgemeinschaft
Während der NS-Zeit standen bei der ärztlichen Behandlung von psychisch Kranken vor allem neurologische sowie rassenanthropologische und rassenhygienische Aspekte im Mittelpunkt. Das Eindringen von Eugenik und Rassenhygiene in die lange gültige Klassifizierung der psychischen Krankheiten führte dazu, dass Schwache und Untüchtige als Gefahr und Bedrohung für den so genannten “erbgesunden und arischen Volkskörper” gesehen wurden. Das waren fast 10 Prozent der deutschen Bevölkerung, wobei die ökonomische Frage und die Frage der Vernichtung gestellt wurden. An dem daraus resultierenden und von Ärzten vor gedachten, initiierten und durchgeführten geheimen Krankenmord des NS-Staates beteiligten sich auch viele Reformpsychiater der Weimarer Republik, die dafür die angeblich wissenschaftlichen Kriterien für die Legitimation zum Töten lieferten. Zentrales Kriterium bei der Vernichtung nicht nur von Anstaltspatienten im Rahmen der einzelnen Phasen der NS-Krankenmordaktion war der Grad der Arbeitsfähigkeit und der Nützlichkeit für die NS-Volksgemeinschaft, die auch von der Therapierbarkeit der Erkrankung abhängig gemacht wurde. Diese Praktik radikalisierte sich noch einmal gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, indem immer neue Menschengruppen in den Kreis derer, die selektiert und dann getötet werden sollten, hineingestellt wurden.
Internationaler Roma-Tag 2016
Das Netzwerk für Demokratie und Courage Saar e. V. (NDC Saar) führt im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ das Modellprojekt „ZusammenWachsen: Vernetzung, Kooperation und Jugendbildung im Themenfeld Antiziganismus“ durch. Gefördert wird es aus Mitteln der Bundesregierung. In diesem Rahmen wird das NDC Saar eine Medienwerkstatt mit Jugendlichen ab 16 Jahren durchführen, sowie vom 18.8. – 21.8.2016 ein Forum in der Bildungsstätte der Arbeitskammer in Kirkel veranstalten.
„Der Blick auf die Nachkriegszeit in der BRD zeigt, dass Antiziganismus nach wie vor nicht an Aktualität verloren hat, sondern es noch immer wichtig ist sich mit dieser Diskriminierungsform auseinander zu setzen, Menschen darüber aufzuklären und solidarisch mit den Betroffenen zu sein, um ihr konsequent entgegentreten zu können. Mit dem Modellprojekt möchte das NDC Saar einen Beitrag dazu leisten“, so Mike Kirsch, Vorsitzender des NDC Saar e. V.
Vor 60 Jahren beschloss der Bundesgerichtshof (BGH) Entschädigungszahlungen an vor 1943 während des Nationalsozialismus verfolgte und in Konzentrationslager deportierte SintiZe und RomNja abzulehnen. Die Entscheidung wurde auf skandalöse Weise begründet. So wurde den Verfolgten abgesprochen, dass sie aus „rassischen“ Gründen verfolgt worden seien. Sie seien auf Grundlage eigenen Fehlverhaltens, wie Diebstahl, „Nicht-Achtung fremden Eigentums“ und einer „Neigung zur Kriminalität“ deportiert worden. Dieses antiziganistische Urteil berief sich in seiner Begründung auf ein Kriminalistiklehrbuch aus der NS-Zeit. Dieses Urteil bedeutete zum einen, dass SintiZe und RomNja Ansprüche auf Entschädigungszahlungen verwehrt wurden. Zum anderen verhinderte es eine Gedenk- und Erinnerungspolitik, die SintiZe und RomNja als Verfolgte und Getötete des Nationalsozialismus einschloss.Die Anerkennung als Verfolgte blieb bis 1982 aus.
Im Februar dieses Jahres distanzierte sich die Präsidentin des Bundesgerichtshof, Bettina Limperg, von dem damaligen Urteil und nannte es „unerträglich“. Die späte Anerkennung und Revidierung des Urteils waren wichtige Forderungen der BürgerInnenrechtsbewegung der SintiZe und RomNja und zeigen noch immer die Notwendigkeit einer starken Selbstorganisation auf.
Eine BürgerInnenrechtbewegung der SintiZe und RomNja gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch auf internationaler Ebene. Ein Meilenstein für diese stellt der Internationale Roma-Tag dar. Er erinnert an den ersten Internationalen Roma-Kongress, der 1971 in London stattfand. Die Delegierten sprachen sich dort für die Selbstbezeichnung Roma anstelle diskriminierender Fremdbezeichnungen aus. Außerdem einigten sie sich auf eine gemeinsame Flagge und Hymne.
Die Verfolgung der Sinti und Roma – Workshop mit Zeitzeugen-Interviews
René Seyedi vom Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg hat für unseren Kongreß einen interessanten Workshop im Gepäck.
In diesem Workshop beschäftigen sich die Teilnehmenden in Kleingruppen mit Zeitzeugeninterviews dreier Überlebender des Völkermords. Ihre Gemeinsamkeiten bestehen in der Zugehörigkeit zur Minderheit der Sinti und Roma sowie der Deportation in das „Zigeunerlager“ im Komplex des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz.
Die Teilnehmenden sollen sich mit den Erlebnissen, Eindrücken und Gefühlen der Zeitzeugen beschäftigen. Der Fokus der Interviews ist dabei auf die Aspekte Selbstbehauptung und Widerstand ausgerichtet. Die Interviews ermöglichen den Teilnehmenden, in Ergänzung zu biografischem Material über „ihren“ Zeitzeugen und weiterführendem historischen Quellenmaterial, eine Auseinandersetzung und Vertiefung des Wissens über die nationalsozialistischen Rassenideologie und den Völkermord an den europäischen Sinti und Roma. Die Teilnehmenden lernen zudem, sich kritisch mit Zeitzeugen-Videointerviews als historische Quellen auseinander zu setzen.
Darüber hinaus wird den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, die historischen Geschehnisse aus der Perspektive der Opfer zu erfahren. Dies eröffnet Ihnen die Chance, die Auswirkungen der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik auf das Leben einzelner Menschen nachzuvollziehen. Auf emotionaler Ebene sollen zudem Empathie und Interesse für die Minderheit der Sinti und Roma geweckt werden.
Die weiteren Workshopangebote unseres vo 24.-26. Juli 2015 in Kirkel stattfindenden Jugendkongresses “Laß uns reden … über Antiziganismus!” werden wir in den nächsten Tagen ebenfalls vorstellen.
Neue Referentin für den Kongress
Wir freuen uns sehr, dass wir Anita Awosusi als Referentin für den Kongress gewinnen konnten. Sie ist seit 30 Jahren als Bürgerrechtlerin mit dem Schwerpunkt auf erinnerungspolitische Arbeit aktiv. Im Rahmen ihrer Arbeit als Leiterin des Bildungsreferats im Dokumentations- und Kulturzentrum deutscher Sinti und Roma hat sie unzählige Workshops zum Thema Antiziganismus und dem an den Sinti und Roma begangenen Völkermord geleitet. Dazu hat sie mehrere Publikationen herausgegeben, drei Bände zur Musik der Sinti und Roma und zwei Bände zum Antiziganismus in der Jugendliteratur.
Internationaler Roma-Tag 2016
Das Netzwerk für Demokratie und Courage Saar e. V. (NDC Saar) führt im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ das Modellprojekt „ZusammenWachsen: Vernetzung, Kooperation und Jugendbildung im Themenfeld Antiziganismus“ durch. Gefördert wird es aus Mitteln der Bundesregierung. In diesem Rahmen wird das NDC Saar eine Medienwerkstatt mit Jugendlichen ab 16 Jahren durchführen, sowie vom 18.8. – 21.8.2016 ein Forum in der Bildungsstätte der Arbeitskammer in Kirkel veranstalten.
„Der Blick auf die Nachkriegszeit in der BRD zeigt, dass Antiziganismus nach wie vor nicht an Aktualität verloren hat, sondern es noch immer wichtig ist sich mit dieser Diskriminierungsform auseinander zu setzen, Menschen darüber aufzuklären und solidarisch mit den Betroffenen zu sein, um ihr konsequent entgegentreten zu können. Mit dem Modellprojekt möchte das NDC Saar einen Beitrag dazu leisten“, so Mike Kirsch, Vorsitzender des NDC Saar e. V.
Vor 60 Jahren beschloss der Bundesgerichtshof (BGH) Entschädigungszahlungen an vor 1943 während des Nationalsozialismus verfolgte und in Konzentrationslager deportierte SintiZe und RomNja abzulehnen. Die Entscheidung wurde auf skandalöse Weise begründet. So wurde den Verfolgten abgesprochen, dass sie aus „rassischen“ Gründen verfolgt worden seien. Sie seien auf Grundlage eigenen Fehlverhaltens, wie Diebstahl, „Nicht-Achtung fremden Eigentums“ und einer „Neigung zur Kriminalität“ deportiert worden. Dieses antiziganistische Urteil berief sich in seiner Begründung auf ein Kriminalistiklehrbuch aus der NS-Zeit. Dieses Urteil bedeutete zum einen, dass SintiZe und RomNja Ansprüche auf Entschädigungszahlungen verwehrt wurden. Zum anderen verhinderte es eine Gedenk- und Erinnerungspolitik, die SintiZe und RomNja als Verfolgte und Getötete des Nationalsozialismus einschloss.Die Anerkennung als Verfolgte blieb bis 1982 aus.
Im Februar dieses Jahres distanzierte sich die Präsidentin des Bundesgerichtshof, Bettina Limperg, von dem damaligen Urteil und nannte es „unerträglich“. Die späte Anerkennung und Revidierung des Urteils waren wichtige Forderungen der BürgerInnenrechtsbewegung der SintiZe und RomNja und zeigen noch immer die Notwendigkeit einer starken Selbstorganisation auf.
Eine BürgerInnenrechtbewegung der SintiZe und RomNja gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch auf internationaler Ebene. Ein Meilenstein für diese stellt der Internationale Roma-Tag dar. Er erinnert an den ersten Internationalen Roma-Kongress, der 1971 in London stattfand. Die Delegierten sprachen sich dort für die Selbstbezeichnung Roma anstelle diskriminierender Fremdbezeichnungen aus. Außerdem einigten sie sich auf eine gemeinsame Flagge und Hymne.
Die Verfolgung der Sinti und Roma – Workshop mit Zeitzeugen-Interviews
René Seyedi vom Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg hat für unseren Kongreß einen interessanten Workshop im Gepäck.
In diesem Workshop beschäftigen sich die Teilnehmenden in Kleingruppen mit Zeitzeugeninterviews dreier Überlebender des Völkermords. Ihre Gemeinsamkeiten bestehen in der Zugehörigkeit zur Minderheit der Sinti und Roma sowie der Deportation in das „Zigeunerlager“ im Komplex des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz.
Die Teilnehmenden sollen sich mit den Erlebnissen, Eindrücken und Gefühlen der Zeitzeugen beschäftigen. Der Fokus der Interviews ist dabei auf die Aspekte Selbstbehauptung und Widerstand ausgerichtet. Die Interviews ermöglichen den Teilnehmenden, in Ergänzung zu biografischem Material über „ihren“ Zeitzeugen und weiterführendem historischen Quellenmaterial, eine Auseinandersetzung und Vertiefung des Wissens über die nationalsozialistischen Rassenideologie und den Völkermord an den europäischen Sinti und Roma. Die Teilnehmenden lernen zudem, sich kritisch mit Zeitzeugen-Videointerviews als historische Quellen auseinander zu setzen.
Darüber hinaus wird den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, die historischen Geschehnisse aus der Perspektive der Opfer zu erfahren. Dies eröffnet Ihnen die Chance, die Auswirkungen der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik auf das Leben einzelner Menschen nachzuvollziehen. Auf emotionaler Ebene sollen zudem Empathie und Interesse für die Minderheit der Sinti und Roma geweckt werden.
Die weiteren Workshopangebote unseres vo 24.-26. Juli 2015 in Kirkel stattfindenden Jugendkongresses “Laß uns reden … über Antiziganismus!” werden wir in den nächsten Tagen ebenfalls vorstellen.
Neue Referentin für den Kongress
Wir freuen uns sehr, dass wir Anita Awosusi als Referentin für den Kongress gewinnen konnten. Sie ist seit 30 Jahren als Bürgerrechtlerin mit dem Schwerpunkt auf erinnerungspolitische Arbeit aktiv. Im Rahmen ihrer Arbeit als Leiterin des Bildungsreferats im Dokumentations- und Kulturzentrum deutscher Sinti und Roma hat sie unzählige Workshops zum Thema Antiziganismus und dem an den Sinti und Roma begangenen Völkermord geleitet. Dazu hat sie mehrere Publikationen herausgegeben, drei Bände zur Musik der Sinti und Roma und zwei Bände zum Antiziganismus in der Jugendliteratur.